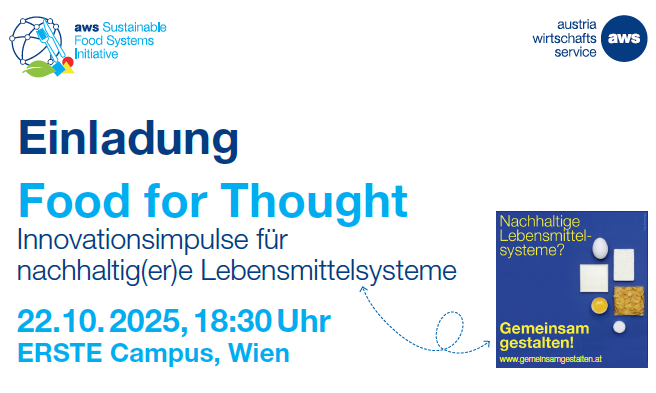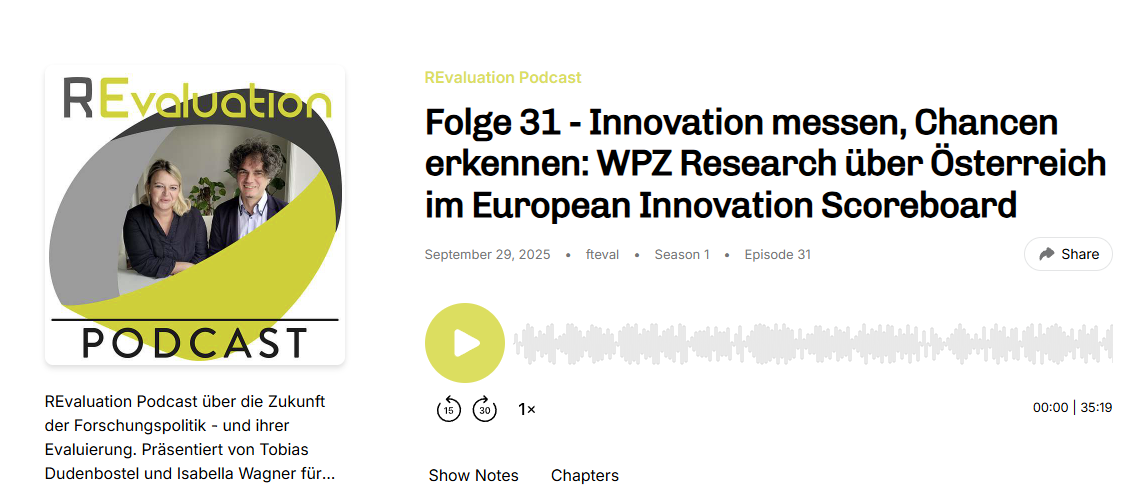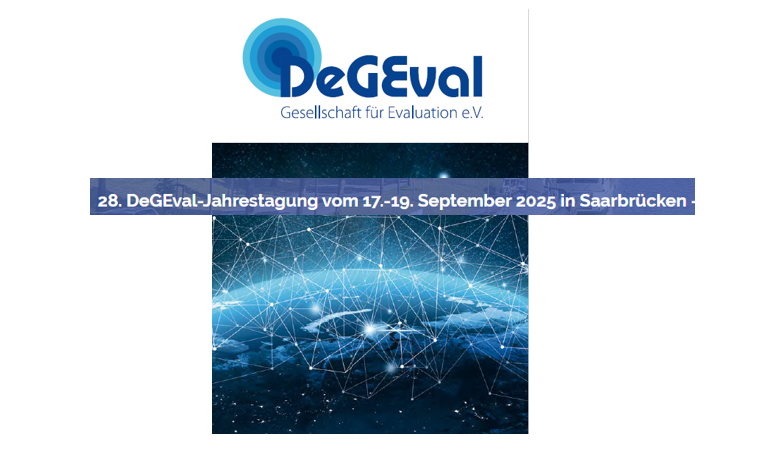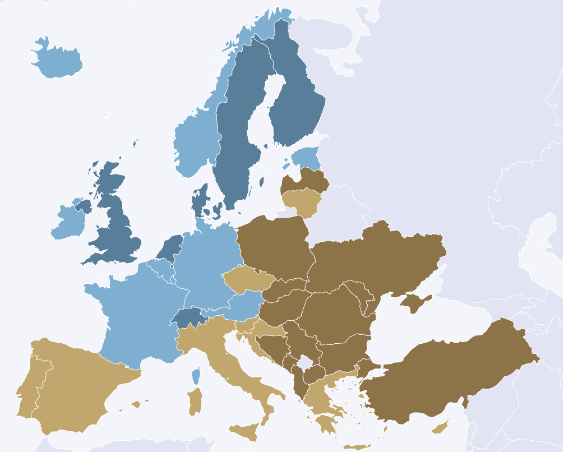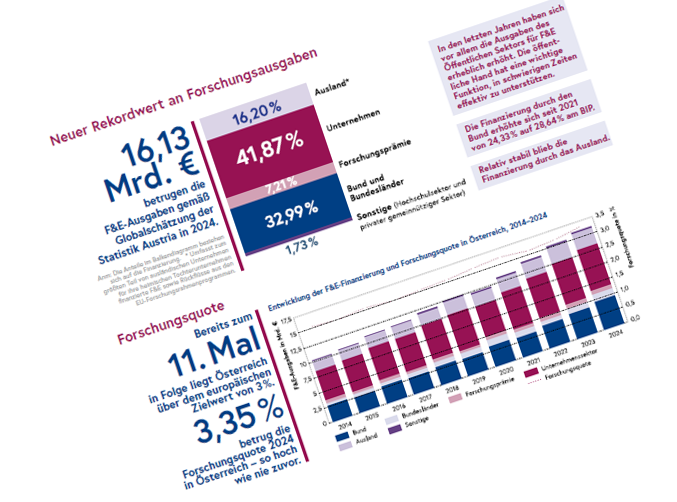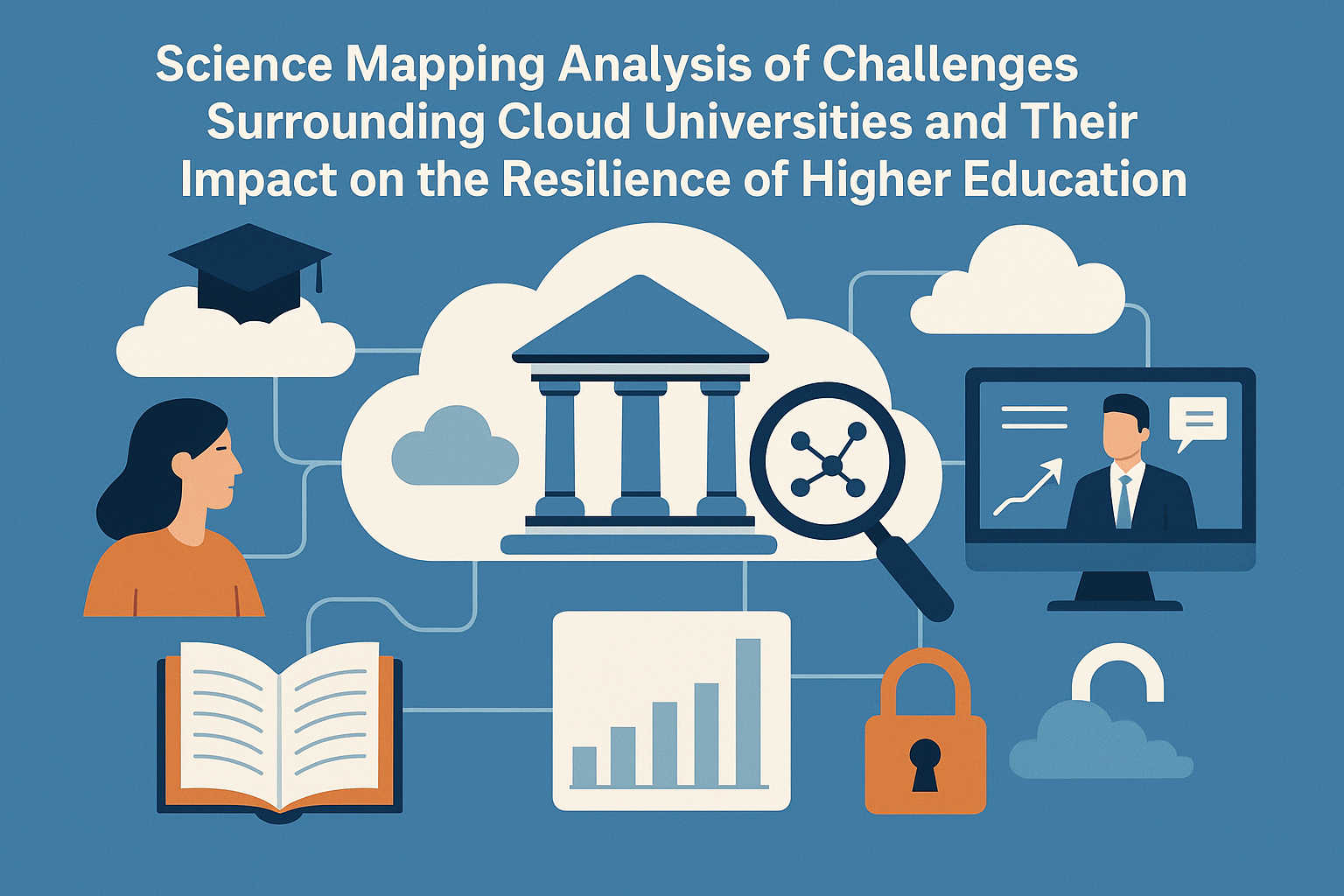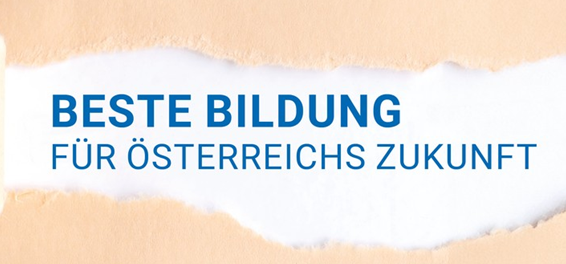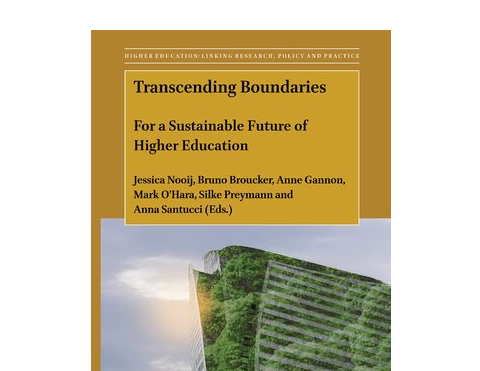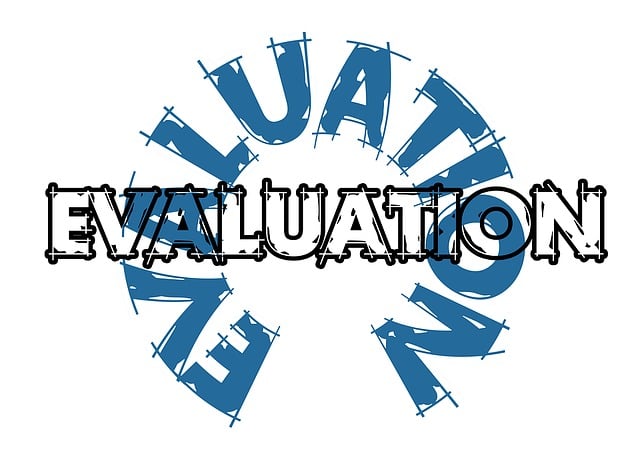09 Dez. 15.1.2026: Hochschulstrategie 2040
Die Industriellenvereinigung lädt Unternehmen, Hochschulen und Politik ein, gemeinsam die Vision zu schärfen und damit zur Weiterentwicklung eines leistungsfähigen, differenzierten, output- und zukunftsorientierten Hochschulsystems beizutragen.
Hochschulstrategie 2040 –
Visionen für ein zukunftsfähiges Hochschulsystem in Österreich
Donnerstag, 15. Jänner 2026, 16:00 bis 18:15 Uhr
Haus der Industrie, Kleiner Festsaal
Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien
(Einlass ab 15:30 Uhr, anschließendes Get-together)
Mit dem Kick-off Anfang Dezember 2025 startete offiziell die Ausarbeitung der Hochschulstrategie 2040. Ziel ist die Profilbildung der 77 Hochschulen und eine neue Arbeitsteilung im System. Hochschulen sind unverzichtbare Partner für die Industrie: Nur gemeinsam lassen sich Innovationsökosysteme schaffen, Technologien auf Weltklasseniveau entwickeln und hochqualifizierte Fachkräfte sichern. Hochschulen müssen als Innovationsmotoren agieren: strategisch vernetzt, gestalten sie national und international den Wandel mit. Die Strategie schafft den Rahmen für gemeinsames Handeln – gegen den MINT-Fachkräftemangel und für Exzellenz, Resilienz und die Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts Österreich, und sie muss auch Antworten auf demografische Veränderungen sowie Internationalisierung geben.